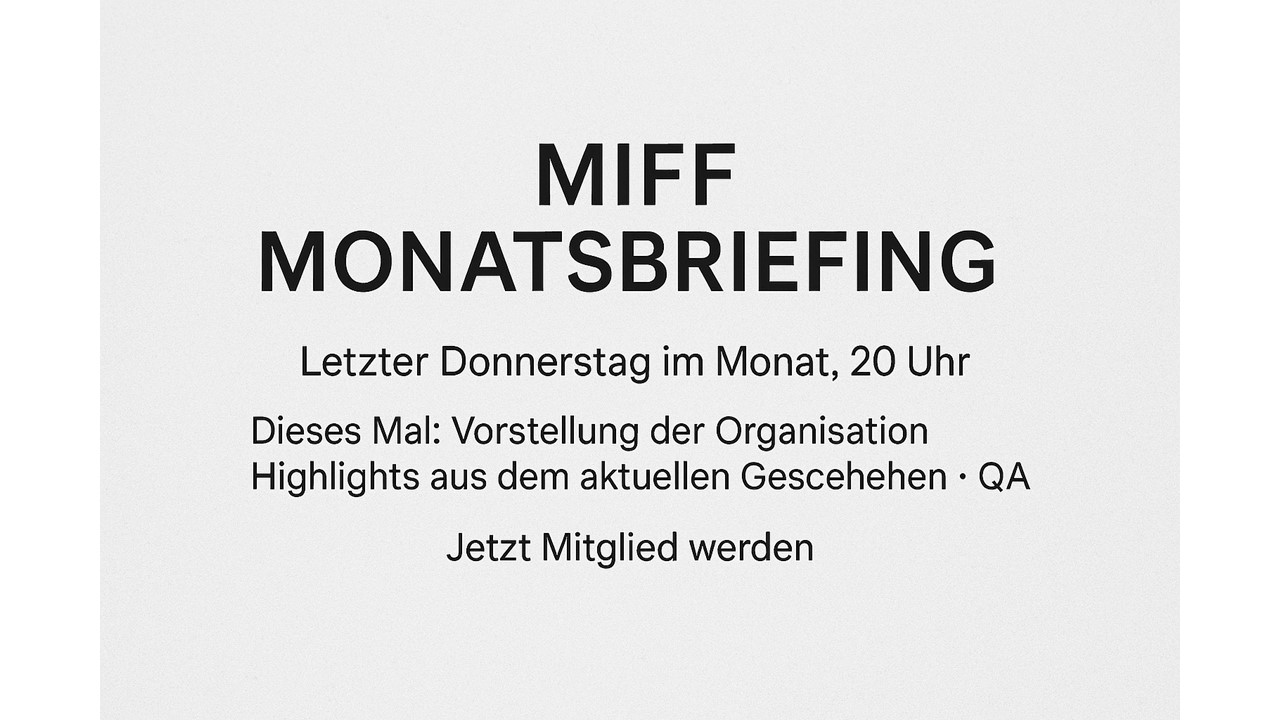Der Oslo-Prozess gilt weithin als gescheitert. Dieser Fokusartikel analysiert die informellen Verhandlungswege des „Oslo-Kanals“, beleuchtet kritisch die zentralen Akteure und leitet Konsequenzen für künftige Friedensinitiativen ab.
👁️ MIFF Fokusartikel
Einleitung
Dieser Monat sind dreißig Jahre vergangen, seit der zweite Teil des sogenannten Oslo-Abkommens („Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip“) am 28. September 1995 in Washington D.C. vom israelischen Premierminister Yitzhak Rabin und dem PLO-Führer Yassir Arafat unterzeichnet wurde. Das Abkommen beinhaltete eine erhebliche Ausweitung der palästinensischen Autonomiegebiete sowie einen entsprechenden Rückzug israelischer Streitkräfte aus diesen Gebieten. Teil 2 war eine Fortsetzung des ersten Oslo-Abkommens („Oslo I“) von 1993 und verfolgte das Ziel, innerhalb von drei Jahren eine Einigung über alle noch offenen Fragen zu erzielen. Wie bekannt ist, gelang dies nicht, und die Oslo-Abkommen führten daher nur zu sehr begrenzten Ergebnissen.
Norwegens Rolle bei der Ausarbeitung des Oslo-Abkommens war bescheidener, als es der Name vermuten lässt. Norwegen war kein Verhandlungspartner, sondern ein „Vermittler“ in diesem Prozess. Auf norwegischer Seite bestand großes Interesse, diese Rolle zu übernehmen – teilweise natürlich, um zu einer Friedenslösung im Nahen Osten beizutragen, aber auch, um Norwegens internationale Stellung und das Ansehen der beteiligten Norweger zu fördern.
Dieser Artikel versucht auf Grundlage offen zugänglicher Quellen die Gründe für das Scheitern des Prozesses zu beleuchten und daraus mögliche Lehren und Schlussfolgerungen zu ziehen.
Die norwegischen Teilnehmer
Das Kernteam auf norwegischer Seite hinter der „Oslo-Kanal“-Initiative bestand aus Außenminister Johan Jørgen Holst (die Sozialdemokraten) von 1993 bis zu seinem Tod im Januar 1994; Jan Egeland (die Sozialdemokraten), Staatssekretär im Außenministerium von 1992 bis 1997; Terje Rød-Larsen vom gewerkschaftsnahen „Zentrum für Forschung, Analyse und Dokumentation“ (FAFO); sowie der Diplomatin und Politikerin Mona Juul, Rød-Larsens Ehefrau. Alle gehörten dem linken politischen Spektrum Norwegens an. Keiner von ihnen war Nahost-Experte, aber Holst wurde bis zu seinem Tod von seiner Ehefrau Marianne Heiberg unterstützt. Heiberg war Nahostforscherin am Norwegischen Institut für Außenpolitik (NUPI) und 1994 Direktorin des Jerusalemer Büros des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA).
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass heute keine offiziellen Dokumente des Prozesses auf norwegischer Seite verfügbar sind. Nach Holsts Tod wurde sein Archiv im Außenministerium von der mittlerweile verstorbenen Marianne Heiberg entfernt. Der Verbleib der Unterlagen ist unbekannt. Ebenso auffällig ist, dass Rød-Larsen, vermutlich die zentrale Figur im Oslo-Prozess, sich geweigert hat, seine Unterlagen aus den Verhandlungen herauszugeben, obwohl die norwegische Archivbehörde darauf hingewiesen hat, dass dies gegen norwegisches Recht verstößt.
Das norwegische Engagement
Das norwegische Engagement im Palästinakonflikt fiel zeitlich mit dem Zerfall der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges 1990 zusammen. Diese historischen Ereignisse eröffneten neue Möglichkeiten für internationale Zusammenarbeit, auch für Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Die norwegische Außenpolitik der 1990er-Jahre war stark geprägt von dem Ideal, Norwegen zu einer „Friedenssupermacht“ zu machen – getragen von „idealistischen“ Kräften. Diese Ambitionen gingen einher mit einem umfassenden Abbau der Verteidigung zugunsten eines starken Fokus auf internationale Zusammenarbeit für Frieden und Versöhnung.
Rød-Larsen, Gründer und damaliger Geschäftsführer von FAFO, hielt sich Anfang der 1990er-Jahre in Kairo auf, wo Mona Juul als Diplomatin an der norwegischen Botschaft tätig war. Dort sondierte er die Möglichkeiten, sozialwissenschaftliche Projekte von FAFO im Nahen Osten zu starten. In diesem Zusammenhang traf er sich mit dem Vorsitzenden des Palästinensischen Roten Halbmonds, Fathi Arafat – dem Bruder von Yassir Arafat – sowie dem Direktor des palästinensischen Krankenhauses in Kairo. In Zusammenarbeit mit letzterem empfahl Rød-Larsen, dass FAFO eine „sozioökonomische Studie“ zur Lage der Bevölkerung im Westjordanland und im Gazastreifen einleiten sollte. Um politische und finanzielle Unterstützung für eine solche Lebenslagenuntersuchung auf beiden Seiten des Konflikts zu gewinnen, wandte er sich an Marianne Heiberg, die auch die Leitung des Projekts übernahm.
Im Februar 1990 beantragte Heiberg beim Außenministerium die Finanzierung des Projekts. Zunächst empfahl die damalige Staatssekretärin für Entwicklungshilfe, Torun Dramdal (Centerpartei), den Antrag abzulehnen, da FAFOs Studie nicht den „entwicklungspolitischen Kriterien“ entspreche. Der damalige Staatssekretär im Außenministerium, Knut Vollebæk (Christliche Volkspartei), sah das Projekt jedoch als mögliche Friedensinitiative im Nahen Osten. Er wurde von Außenminister Kjell Magne Bondevik (Christliche Volkspartei) sowie scheinbar auch vom Entwicklungsminister Tom Vraalsen (Centerpartei) unterstützt. Es wurden 278.000 NOK für eine Pilotstudie bewilligt. Diese wurde 1990–1991 durchgeführt und sollte die Grundlage für eine umfassende Lebenslagenuntersuchung der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland und Gaza bewerten.
Wenig überraschend kam FAFO zu dem Schluss, dass eine solche Studie sinnvoll sei. Daher wurde 1991 ein weiterer Antrag beim Außenministerium gestellt. Dieses hielt eine erweiterte Studie für „interessant und notwendig“, um eine systematische Informationsgrundlage für die Entwicklungshilfepolitik zu schaffen. Ein Jahr später erhielt FAFO eine zusätzliche Förderung von vier Millionen NOK zur Aufwertung der Studie – wegen „veränderter Voraussetzungen und Erwartungen“. Das Projekt wurde nun als von großer politischer Bedeutung für den Friedensprozess im Nahen Osten betrachtet, und die zusätzliche Förderung wurde in „Rekordzeit“ bewilligt. Staatssekretär Jan Egeland soll die Zusage mündlich erteilt haben, noch bevor sie formal genehmigt war. Ab 1992 wurde sämtliche Hilfe für die palästinensischen Gebiete unter der politischen Leitung des Außenministeriums gebündelt, mit dem Ziel, den Friedensprozess zu unterstützen und Norwegen als Akteur sichtbar zu machen.
1991 leitete die USA einen Friedensprozess in Madrid ein, der parallel zu bilateralen Verhandlungen in Washington stattfand. Im Januar 1992 wurden in Moskau multilaterale Friedensverhandlungen für den Nahen Osten gestartet, die erstmals direkte Gespräche zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten beinhalteten. Die Palästinenser nahmen jedoch nicht teil, da das PLO-Forderung, auch Palästinenser außerhalb des Westjordanlands einzubeziehen, nicht akzeptiert wurde. Norwegen beteiligte sich ebenfalls an den Moskauer Verhandlungen mit dem Ziel, eine aktive Rolle zu spielen und die Lebenslagenstudie als Türöffner für Einfluss in der Arbeitsgruppe für Flüchtlingsfragen zu nutzen. In diesem Zusammenhang bot Norwegen an, ein zukünftiges Treffen auszurichten – ein Angebot, das angenommen wurde.
Die Vorbereitungen für dieses Treffen, das im Mai 1993 in Norwegen stattfand, spiegelten Norwegens Wunsch wider, mehr als nur Gastgeber zu sein. Die Lebenslagenstudie und Rød-Larsens zentrale Rolle darin waren ein zentrales Thema der Konferenz. Es wurde ein Text zum Flüchtlingsproblem verabschiedet, der von sowohl der israelischen als auch der palästinensischen Delegation gebilligt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch öffentlich noch nicht bekannt, dass bereits seit fast einem Jahr ein geheimer Hinterkanal vorbereitet worden war.
Der Prozess
Bereits im Frühjahr 1992 sollen norwegische Behörden sowohl von israelischer Seite als auch von der PLO kontaktiert worden sein, mit der Bitte, einen „geheimen Kanal“ für Verhandlungen zwischen Israel und der PLO einzurichten. Hintergrund dieser Bitte war die Frustration auf beiden Seiten über das mangelnde Vorankommen im Friedensprozess. Norwegens enge Beziehung zu Israel in den 1950er- und 60er-Jahren sowie das damalige Ansehen Norwegens als „ehrlicher Makler“ sollen dabei ausschlaggebende Faktoren für diesen Wunsch gewesen sein. Yitzhak Rabin war von Juli 1992 bis zu seinem Attentat im November 1995 israelischer Premierminister, während die PLO unter der Führung von Arafat stand.
Hans Wilhelm Longva, Abteilungsleiter in der Rechtsabteilung des norwegischen Außenministeriums, und Rød-Larsen wurden zentrale Akteure in dieser Arbeit, die im Januar 1993 begann. Es war jedoch von Anfang an klar, dass Norwegens Rolle die eines Vermittlers und nicht eines aktiven Verhandlungsführers sein sollte. Es wurde sogar angedeutet, dass die gesamte Lebensstandardstudie, die formale Grundlage für Norwegens Engagement, für beide Seiten – Israelis wie Palästinenser – völlig uninteressant war.
Der direkte Kontakt zwischen israelischen Behörden und der PLO war höchst sensibel und potenziell kontrovers auf beiden Seiten. Umso bedeutender war es, dass die Verhandlungen geheim gehalten wurden. Sie wurden daher abseits der Öffentlichkeit und mit größter Diskretion vorbereitet und durchgeführt. FAFO hatte de facto die Hauptverantwortung für die Durchführung, die durch öffentliche Mittel finanziert wurde.
Mit Ausnahme von Heiberg waren keiner der beteiligten Initiatoren Experten für den Nahen Osten oder verfügten über besondere Erfahrung in der Region. Daher kann hinterfragt werden, ob sie die Dynamik des israelisch-palästinensischen Konflikts ausreichend verstanden – geschweige denn in der Lage waren, dessen komplexe Ursachen zu lösen. Rückblickend scheint es, dass die norwegischen Beteiligten fundamentale Fragen des Nahostkonflikts unterschätzten oder übersahen und daher mit unrealistischen Erwartungen an den Erfolg herangingen.
Dazu zählte nicht zuletzt die Tatsache, dass eine Mehrheit der arabischen Bevölkerung in Palästina die bloße Existenz eines jüdischen Staates auf Grundlage der UN-Resolution 181 von 1947 über die Gründung zweier Staaten im ehemaligen britischen Mandatsgebiet ablehnte. Ein beträchtlicher Teil der arabischen Bevölkerung lehnte gar das Recht der Juden ab, sich überhaupt irgendwo in diesem Gebiet niederzulassen. Diese Haltung wurde – wie heute – vor allem von den Terrororganisationen Hamas und Palestine Islamic Jihad (PIJ) vertreten. Diese Gruppierungen waren – wie heute – totalitäre Organisationen, die alle verfügbaren Mittel einsetzen wollten, um einen arabisch-islamischen Staat „vom Fluss bis zum Meer“ zu errichten.
Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) hatte ihrerseits seit 1964 unter der Führung von Yassir Arafat Krieg gegen Israel geführt. Die PLO war eine säkulare Bewegung und daher gegenüber Verhandlungen über eine Zweistaatenlösung pragmatischer eingestellt als die Dschihadisten, stand aber unter deren Druck. Auch wenn Teile der arabischen Bevölkerung – sowohl innerhalb Israels als auch in Palästina – bereit waren, eine Zweistaatenlösung zu akzeptieren, wurden sie von der PLO kaum konsultiert – einer Organisation, die selbst nicht demokratisch war – und die im Gegensatz zu Hamas und PIJ keine Unterstützung von arabischen Staaten der Region genoss.
Die Ergebnisse
Oslo I wurde am 13. September 1993 offiziell in Washington D.C. vom israelischen Außenminister Shimon Peres und Mahmoud Abbas unterzeichnet. Es handelte sich um eine Grundsatzerklärung, insofern sie einen Rahmen für die Errichtung einer palästinensischen Selbstverwaltung und einen schrittweisen israelischen Rückzug aus Gaza und dem Westjordanland festlegte. Daher wurde sie eher als Zeitplan denn als Friedensplan charakterisiert. Man einigte sich auch darauf, dass die PLO-Führung sich zunächst in Gaza und später in Ramallah etablieren könne. Die Vereinbarung beinhaltete darüber hinaus eine gegenseitige Anerkennung und die Einführung einer palästinensischen Selbstverwaltung über alle besetzten Gebiete innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren. Einige schwierige Fragen – etwa die Grenzziehung, der zukünftige Status Jerusalems, jüdische Siedlungen in besetzten Gebieten sowie der Flüchtlingsstatus – wurden vertagt.
Oslo II – das Interimsabkommen – wurde am 28. September 1995 formell von Premierminister Rabin und PLO-Führer Arafat unterzeichnet. Vertreter der USA, Russlands, der EU, Ägyptens, Jordaniens und Norwegens waren als Zeugen anwesend. Das Abkommen erweiterte die palästinensischen Autonomiegebiete um Bethlehem, Jenin, Nablus, Qalqiliya, Ramallah und Tulkarem sowie um etwa 450 Dörfer, parallel zum Abzug israelischer Truppen aus diesen Regionen. Die Gebiete wurden in Kategorien A und B unterteilt: A-Gebiete sollten unter palästinensischer Kontrolle stehen, B-Gebiete unter gemeinsamer Kontrolle. Die restlichen 15 % des Territoriums mit jüdischer Bevölkerung sollten unter israelischer Kontrolle verbleiben. Das Abkommen bildete zudem die Grundlage für die Einrichtung einer temporären palästinensischen Selbstverwaltung unter der sogenannten Palestinian Authority (PA).
Wie bekannt, hielt das Abkommen nicht. Auf palästinensischer Seite wurde Arafat dafür kritisiert, dass er andere Teile der palästinensischen Machtstruktur nicht konsultiert und dass er den Verzicht auf Gebiete mit jüdischer Bevölkerung akzeptiert hatte. Vor allem Hamas und PIJ äußerten starke Kritik. Ein dritter Kritikpunkt war der Verzicht der PLO auf den bewaffneten Widerstand. Infolge dieser Unzufriedenheit wurden bewaffnete Aufstände fortgesetzt. Auch in Israel wurde das Abkommen kritisiert – insbesondere im Hinblick auf die Aufgabe historischer jüdischer Gebiete in Judäa und Samaria, was für orthodoxe Juden und Siedler gleichermaßen inakzeptabel war. Eine Einigung über die Teilung Jerusalems wurde ebenfalls nicht erreicht. Rückblickend erscheint es naheliegend, dass diese Schwächen die Umsetzung und Einhaltung der Vereinbarungen unmöglich machten.
Epilog
Rückblickend – aber auch aus erfahrungsgestützter Perspektive – liegt die Schlussfolgerung nahe, dass das Potenzial für einen dauerhaften Frieden Mitte der 1990er Jahre von Anfang an begrenzt und vielleicht sogar illusorisch war. Das größte Hindernis für eine Friedenslösung schien damals wie heute darin zu bestehen, dass dominierende Kräfte – wenn auch nicht unbedingt die Bevölkerung – auf arabisch-islamischer Seite die Konfrontation der friedlichen Koexistenz vorzogen. Dies ist eine klassische Strategie totalitärer Bewegungen. Soweit eine Zweistaatenlösung heute noch relevant ist, kann sie folglich erst dann verwirklicht werden, wenn diese Kräfte beseitigt und eine Form von Demokratie in Palästina eingeführt worden ist. Gleichzeitig wäre die vollständige Eingliederung von Judäa und Samaria in Israel sowie eine uneingeschränkte Ausweitung israelischer Siedlungen im Westjordanland offensichtlich ebenfalls unvereinbar mit einer Friedenslösung – vorausgesetzt, dies wären offizielle israelische Positionen.
Trotz des Scheiterns des Oslo-Prozesses wird dieser in norwegischen Medien oft als eine Art Höhepunkt norwegischer Diplomatie dargestellt. Es fällt jedoch schwer, in einer solchen Einschätzung eine Logik zu erkennen – es sei denn, norwegische Teilnahme an internationalen Verhandlungen wird unabhängig vom Ergebnis als bewundernswert angesehen. Sollte eines Tages vollständige Transparenz über den Prozess bestehen, wäre es vielleicht möglich, eine vollständige und ausgewogene Analyse des Prozesses und der norwegischen Rolle darin vorzunehmen – soweit daran überhaupt ein Interesse besteht.
Es wird weiterhin darüber spekuliert, warum die Dokumente des Prozesses verschwunden sind und weshalb die norwegischen Behörden offenbar wenig Interesse zeigen, diesen Vorgang aufzuklären – trotz des Verstoßes gegen das Öffentlichkeitsgesetz. Naheliegend ist die Annahme, dass einige der Beteiligten – mit Unterstützung der Regierung – Einzelheiten des Prozesses verbergen möchten, vermutlich in Bezug auf ihre eigene Rolle. Wie erwähnt, sind zwei der Beteiligten, Holst und Heiberg, verstorben. Von den übrigen ist Juul heute norwegischer Botschafter in Jordanien, während sich Rød-Larsen im Oktober 2020 aufgrund eines umfangreichen Finanzskandals im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als Direktor des International Peace Institute (IPI) in New York aus dem öffentlichen Leben zurückzog. Egeland ist heute Generalsekretär der größten humanitären Organisation Norwegens, des Norwegischen Flüchtlingsrats – eine Plattform, die er häufig für Kritik an Israel, aber nie an Hamas, nutzt.
Bemerkenswert ist, dass keiner der heute noch lebenden Teilnehmer versucht hat, die Ursachen für das Scheitern des Oslo-Prozesses zu analysieren. Sollte man etwas aus dem Prozess lernen, dann wohl, dass eine Friedenslösung, die direkt oder indirekt terroristische Organisationen wie Hamas und PIJ einbezieht, kaum Aussicht auf Erfolg hat, da solche Gruppen Frieden nur zu ihren eigenen Bedingungen akzeptieren. Dies bedeutet nicht, dass Friedensarbeit grundsätzlich sinnlos wäre, und auch nicht, dass der Oslo-Prozess per se ein Fehler war, aber dass die Voraussetzungen für Frieden zu Beginn der Verhandlungen klar definiert sein müssen. Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass Norwegen heute seine Rolle als Friedensvermittler verspielt hat – durch die einseitige Kritik der norwegischen Regierung an Israel im aktuellen Konflikt mit islamistischen Terrorgruppen, deren erklärtes Ziel die Auslöschung Israels ist. Neue „Oslo-Prozesse“ sind daher kaum vorstellbar.
Erik Breidlid, August 2025